Startseite › Foren › Kulturgut › Das musikalische Philosophicum › Pop Crimes: Jan Lustiger denkt laut über Platten nach.
-
AutorBeiträge
-
Jan LustigerFranz, es freut mich sehr, dass dich der Text derart berührt. Das ehrt mich wirklich und dürfte eines der schönsten Feedbacks sein, die ich bisher überhaupt auf einen Text bekommen habe. Danke dafür!
Nichts zu danken, war mir auch eine Freude, den Text zu würdigen. Aber leider werden es halt viele Leute doch nie begreifen, dass die P.S.Bs mehr als ein Spaß-Duo sind.
--
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ (Goethe) "Allerhand Durcheinand #100, 04.06.2024, 22:00 Uhr https://www.radiostonefm.de/naechste-sendungen/8993-240606-allerhand-durcheinand-102Highlights von Rolling-Stone.deHarry Nilsson: Leben und Tod eines Egozentrikers
01. April 1984: Marvin Gaye wird vom eigenen Vater erschossen
Die letzten Stunden im Leben von John Bonham
Kritik: „Abba: Voyage“ in London: Was die Abbatare können, was sie nicht können
Die letzten Tage im Leben von Tupac Shakur
Eric Clapton: 10 Dinge über Slowhand, die man wissen muss
WerbungIrrlichtEin wirklich beeindruckender und auch sehr berührender Text, der sich so spannend liest wie ein gutes Buch. Man merkt, dass Dir die Band viel bedeutet und Du Dir über jedes Wort Gedanken gemacht hast – und eine ganze Menge Zweitliteratur in der Hinterhand hast, um Deine Argumentation zu stützen. Herausgekommen ist erfreulicherweise aber keine trockene Abhandlung, sondern ein kleines Gesamtkunstwerk über Musik, Popkultur, Weltgeschehen – und ja: Die Zeit. Mehr kann ein Text über einen Song eigentlich gar nicht leisten. Kompliment!
Danke auch für das große Kompliment! Wie sieht’s eigentlich zwischen dir und den PSB aus?
--
Jan LustigerWie sieht’s eigentlich zwischen dir und den PSB aus?
Puh, da fragst Du was. Ich kenne von den Beiden bewusst vielleicht ein Dutzend Tracks, also praktisch nichts. „Jealousy“ mag ich ziemlich gerne, aber ansonsten ist da wenig an Hingabe entstanden bislang. Dass die Texte der PSB einiges hergeben habe ich schon registriert und an den Songs liegt es auch nicht, sondern eher daran, dass mich das alles stimmlich nicht wirklich kickt. Mal ganz verkürzt ausgedrückt. Mag nun natürlich sein, dass ich im Gesamtwerk einiges finden würde, was mich fasziniert, aber da muss ein Grundinteresse da sein – und wenn es mit dem Gesang hakt, muss der Rest so gewaltig ausfallen, dass ich darüber hinwegsehen kann. Das ist hier bislang nicht der Fall gewesen und es gibt so viel, was mich die letzten Jahre eher aufgefordert hat, meine Luppe drauf zu halten.

--
Hold on Magnolia to that great highway moonBravo!
Being Boring ist mein ewiger Lieblingssong von den PSB. Ein Stück aufkeimender Lust, als junger Mensch sich selbst und die Welt zu entdecken und die Melancholie, als älterer Mensch auf diese Zeit zurückzublicken. Ob es dann tatsächlich so berauschend war, ist eine andere Frage …
Auch das Video ist göttlich. Das ganze Album Behaviour ist großartig. Sicher ein ganz großer Moment der PSB, des Elektopop und der Popmusik der späten 80er / frühen 90er Jahre überhaupt. Hat daher auch seinen Platz in meiner Top 100 gefunden. In meiner kurzen Tagline schrieb ich, dass Elektopop damit nachdenklich und analog wurde (was die Instrumentierung mit Vintage-Synthies betrifft). Er wird damit auch gleichzeitig nostalgisch und erwachsen, da er auf die Jugendzeit zurückblickt.
--
Das RS-Forum droht, vom Netz zu gehen. Registriert euch bei StoneFM !Zappa1Nichts zu danken, war mir auch eine Freude, den Text zu würdigen. Aber leider werden es halt viele Leute doch nie begreifen, dass die P.S.Bs mehr als ein Spaß-Duo sind.
Kürzlich hat mir jemand gesagt, dass er die Pet Shop Boys für zu intellektuell und abgehoben hält.. (Und betreffende Person liebt elektronischen Pop.) Nun ja, wenn man auf beiden Seiten vom Pferd fällt, ist das vielleicht gar kein schlechtes Zeichen.
Interessant finde ich den Gedanken, dass hedonistische Jugendbewegung und Schwulenbewegung (genau wie diverse andere Emanzipationsbewegungen) in dem Titel eigentlich nur als verschiedene Seiten der gleichen Medallie gesehen werden, was den Punkt sehr gut trifft.
--
AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970
Beiträge: 0
@ Jan
Neben Kramer (der hier seine Serie leider nicht mehr fortsetzt) und Mikko bist du jemand, der es versteht, den Leser, auch wenn er von der Band/dem Interpreten noch nie etwas gehört hat, dazu zu bringen, sich auf Grund der Rezension mit ihm zu beschäftigen! Großes Lob an deine Fähigkeit, Musik in Texten erleb-/erfahrbar zu machen. Das gelingt nicht sehr vielen Menschen.
Ich freue mich auf deine nächsten Beiträge hier!!!
--
Sehr aufschlussreicher Text, Jan! Habe ich gern gelesen.
--
Marina and the Diamonds – Froot
[2015]
—
***½
—Am 08.08.2013 beging Electra Heart ihren [I]Rock ’n‘ Roll Suicide. Im letzten Clip der Video-Reihe zu ihrem zweiten Album wischt sich Marina Diamandis das Herz von der Backe und begräbt so den titelgebenden Charakter, für den es stand. Nach über einem Jahr als intrigierende Pop-Personifikation ist aus „Welcome to the life of Electra Heart“ wieder „Actually, my name’s Marina“ geworden.
Doch obwohl der Anteil an Electropop auf ihrem nun veröffentlichten dritten Album zurückgefahren wurde und der Sound nicht mehr so offensichtlich mit kontemporären Chart-Produktionen liebäugelt, bedeutet Froot, das Diamandis im Alleingang schrieb und mit David Kosten (Bat for Lashes, Everything Everything) produzierte, kein simples Zurückdrehen der Uhren auf 2010. Diamandis orientiert sich stattdessen wieder neu, und lässt den spielerisch in „Girl Pop“ gepackten Sarkasmus von The Family Jewels ebenso hinter sich wie den subversiven Inszenierungs-Pop Electra Hearts. Das neue Motto: „I’ve put my money where my mouth is / for the first time in my life“.
Sie entledigt sich also genau der Distanz, aus der heraus ihre ersten beiden Alben auf unterschiedliche Weise mit popkulturellen Prinzipien spielten. Im Gegensatz zu Electra Heart, das eine konsequente Fortführung der auf The Family Jewels beschriebenen Welt aus Perspektive einer direkter involvierten Kunstfigur war, ist Froot tatsächlich etwas, was seinem Vorgänger fehldiagnostiziert wurde: Ein Bruch mit vielem, was das Projekt Marina and the Diamonds bisher ausmachte. Doch den Fehler, jetzt mit persönlichen Songs ihre Gefühlswelt zum Gebiet allgemeinen Interesses zu erklären, macht Diamandis nicht. Stattdessen ändert sie ihren Fokus.
Der erste Hinweis auf die Änderung des künstlerischen Ansatzes findet sich am Anfang des Albums. Nicht in Form des ersten Songs Happy an sich, sondern in der Tatsache, eben dass dieser der Opener ist. Waren Are You Satisfied? auf The Family Jewels und Bubblegum Bitch auf Electra Heart noch offensive Ansagen – nahezu Manifeste – für das, was ihnen folgen sollte, ist Happy eine in sich geschlossene Ballade, die noch dazu mit einer anderen Neuheit im Diamonds-Kosmos geschlossen wird: einem Happy End. Doch aus diesem Start zu ziehen, dass Froot sich in die Tradition des Pop-Albums als kontextlose Songsammlung einordnet, wäre der falsche Schluss. Happy ist da, um in Frage gestellt zu werden.
Was selbstverständlich direkt im Anschluss passiert. Dann nämlich gehört Froot, Titeltrack und erste Single (passenderweise mit Happy als B-Seite), das Rampenlicht, und mit ihm Verführung, Vergänglichkeit und Sünde, also die Antithesen zu quasi allem, wofür Happy steht. Beide Songs sind von christlicher Theologie geprägt. Happy handelt von Selbstgenügsamkeit, Geduld und Halt: “I sang a hymn to bring me peace / And then it came, a melody / […] And all the sadness inside me / melted away like I was free”. Die Melodie der gesungenen Hymne (!) kommt nicht aus dem Nichts, sondern aus der Sängerin selbst heraus. Folglich findet sie einen Frieden mit sich selbst, der die Suche nach Glück in der Zwischenmenschlichkeit beendet und stattdessen den neugefundenen Glauben an einen Gott, der als Ursache für die mysteriöse Melodie identifiziert wird, voraussetzt: „I haven’t found the one for me / But I believe in divinity“.
Doch kaum ist dieser Frieden gefunden, tritt mit Froot die Verführung zur Sünde auf den Plan. Rein musikalisch ist dieser Bruch bereits im stampfenden Disco-Beat mit geslapptem Bass und Synthesizern zu spüren, die Tanzfläche wird zum Baum mit der verbotenen Frucht, womit wir auch wieder bei den Lyrics wären. Denn natürlich ist diese die titelgebende Frucht, die ihrem Opfer zuflüstert: „Living La Dolce Vita / Life couldn’t get much sweeter / […] Babe, I love you a lot / I’ll give you all I’ve got / […] I’ve been saving all my summers for you / like froot“. Zeit, dieses Angebot abzuwägen, gibt es keine, denn wo es keinen göttlichen Frieden gibt, gibt es auch kein Jenseits, das materialistische Ende ist absolut: „Leave it too long, I’ll go rot / like an apple you forgot / Birds and worms will come for me / The cycle of life is complete“. Die biblische Metaphorik steht Seite an Seite mit sexuellen Bildern („My body is ready / My branches are heavy“), Diamandis‘ Vocals – mal bedrohlich tief gehaucht, mal Unschuld vortäuschend hoch – versprühen dabei eine Erotik, die dazu ihr Übriges tut.
Die Grundlagen sind damit gelegt. Auch I’m a Ruin kommt auf diesen Konflikt zurück, indem es ihm eine moderne Beziehungskrise als inneres Schlachtfeld zur Verfügung stellt. Die Unschuld liegt dabei in der Love Interest, die Sünde in der Protagonistin, die, hin- und hergerissen zwischen dem Komfort innerhalb und der Freiheit außerhalb einer bürgerlichen Beziehung, schließlich mit dem am stärksten in ihr ausgeprägtem Impuls geht, und ihre große Liebe verlässt.
Perfide ist dabei die Auswegslosigkeit der Situation, wenn man sie im Sinne von Happy lösen möchte: „I’ve been doing things I shouldn’t do / But I don’t wanna say goodbye / But baby, I don’t wanna lie / to you“. Um die Beziehung fortführen und dem Laster entsagen zu können, müsste sie eine Lüge, also im Widerspruch mit einem der zehn Gebote, leben. Der Sieg des Froot-Aspektes ist folglich unvermeidbar. Im Anschluss wirkt Blue wie eine Fortsetzung. Der Bruch ist getan und wird schnell bereut. Von einer Wiedervereinigung ist aber nicht die Rede. Stattdessen soll der Abschied hinausgezögert werden. Im Gegensatz zu I’m a Ruin porträtiert Blue aber nicht die Entscheidung zur Trennung als von Egoismus gezeichnet, sondern macht diesen ganz im Gegenteil zum Liebesmotiv: „No, I don’t love you / No, I don’t care / I just wanne be held / when I’m scared“. Der fröhliche Offbeat und die optimistische Melodie stehen gänzlich im Kontrast zu diesem in seiner Arroganz verletzlichen Geständnis.
Mit Forget geht die Beichte weiter: „I’ve been dancing with the devil / I love that he pretends to care“. Mit dem Vertrauen hat Diamandis zu diesen Zeitpunkt des Albums bereits mehrmals gebrochen, und wenn dieses nichts zählt, ist das bloße Versprechen genauso viel wert. Forget ist charttauglicher Power Pop. Laute Gitarren verleihen dem Refrain den Schub, den er braucht, um das trotzige Selbstbewusstsein, das er verkörpert, voranzutreiben: Der erste amtliche Rock-Moment von Marina and the Diamonds (Nein, Bubblegum Bitch war keiner). Auch hier gibt es ein christliches Motiv, dem das lyrische Ich nicht gerecht werden kann, aber will – die Vergebung.
Savages ist dann eine Annäherung an die The Family Jewels-Ära. Die Nummer hat Punch und ist bissig, wenn auch weniger subtil als das auf dem Debütalbum noch der Fall war. Der Song sucht die Ursachen für das unmoralische Verhalten des Menschen in seiner primitiven Veranlagung, über die ein kultivierter Überbau quasi nur gestülpt wurde: „Underneath it all, we’re just savages / hidden behind shirts, ties and marriages“. Eine rein säkulare Betrachtungsweise, die dem ewigen Spiel von Schuld und Sühne gewaltig Wind aus den Segeln nimmt. Konsequenterweise heißt es dann auch: „I’m not afraid of god / I am afraid of man“.
Angst ist es schließlich auch, die sich auf dem Grund der Konflikte befindet, die Froot behandelt. Im Closer Immortal singt Diamandis: „I wanna be immortal / like a god in the sky / I wanna be a silk flower / like I’m never gonna die“. Die Angst vor dem Tod ist ein Antrieb für die in Happy gefundene Religiösität wie auch für den Hedonismus von Froot, der das große ungewisse Morgen lieber durch ein schnell gelebtes Jetzt ersetzen möchte. Doch diese Angst wird auch zum Antrieb für ein zentrales Motiv menschlichen Fortschritts – ein Erbe zu hinterlassen. „Everybody dies / chasing after time / So keep me alive“ sind die letzten Zeilen der Albums, ehe das Wort „Race“ (in der Bedeutung „Rennen“) bis zum Schluss wiederholt wird; die menschliche Existenz als ein Rennen gegen die Vergänglichkeit. So endet Froot mit einem Bild, das all die Querelen der Songs davor in ein großes Bild einordnet, das ihre Signifikanz schwächt, aber ihre Motivationen verdeutlicht.
Bei aller universeller Thematik wird der Gegenwartsbezug aber nicht vergessen. Can’t Pin Me Down etwa thematisiert postmoderne Identitätspolitik. „Do you really want me to write a feminist anthem? / I’m happy cooking dinner in the kitchen for my husband“ ist kein antifeministisches Statement, aber ein antidogmatisches. Emanzipatorischer Anspruch muss differenzieren können, sonst verkommen die fraglichen „Subjekte“ zu bloßen Nummern, weswegen sich Diamandis‘ trotzige Figur weigert, ihre Nummer zu verraten („You don’t have my number / No, you can’t pin me down“). Alles andere würde dem gegensätzlichen Wesen des Menschen nicht gerecht (“All these contradictions pouring out of me / Just another girl in the 21st century“). Einen letzten Twist erhält der Song, wenn verraten wird, dass die Person, die diese vermeintlich feministischen Ansprüche stellt, männlich ist – durch die bloße Einführung feministischer Identität findet noch keine Befreiung statt, das Machtgefüge bleibt intakt. Logisch also, dass auch Can’t Pin Me Down vom starken Selbstbewusstsein seiner Hauptfigur geprägt ist, das sich im Sarkasmus der Zeile „Do you like my body? / Do you like my mind? / What is it that you are having trouble to define?” äußert.
Überhaupt ist Froot ein Album, dessen Attitüde gut in den spätestens seit Beyoncés selbstbetiteltem Album Ende 2013 auch im Mainstream vorherrschenden Hochglanz-Feminismus passt, der selbstbestimmte Sexualität preist, aber nicht davor zurückschreckt, die allzu menschlichen Risse in diesem Selbstbewusstsein zu offenbaren. Diamandis ist dabei allerdings weniger auf Emotion fixiert, dafür ist ihre Persona als Performerin nach wie vor zu bissig. Dennoch drückt sie Gefühle hier ungefilterter aus als auf ihren Vorgängeralben, die viel größeren Wert auf popkulturelle Reflexion durch subversive Inszenierung legten. Nur logisch also, dass viele der Songs für sich alleine betrachtet persönlicher wirken, als man das von ihr gewohnt ist.
Thematisch ist Diamandis viel mehr am Aspekt der Menschlichkeit interessiert als an den großen Statements der A-List-Celebrities. Das gilt auch für die Identitätsfrage: Persönliches ist hier nicht für sich stehender (politisierter) Gegenstandspunkt, sondern die Art, in der sich existenzielle Fragen menschlichen Daseins im 21. Jahrhundert äußern. Das bedeutet auch, dass die Reise weg geht vom direkten Sezieren von Massenkultur direkt am Gegenstand, und hin zu ebendiesen Fragen der Masse innerhalb dieser Kultur. Dadurch gibt es zwar durchaus ein paar Einbüßungen, gerade was die Wirkung der auf Electra Heart noch so präzise platzierten Spitzen angeht, dennoch ist Froot ein durchdachteres Pop-Album, als man es lose betrachtet annehmen möchte.
—
--
Sich so ausführlich und gedankenreich mit einem Album zu befassen, dass man gut, aber nicht herausragend findet, ist schon bemerkenswert. Kannst Du vielleicht noch etwas erläutern, was Du an „Froot“ im Vergleich zu den vorigen Alben vermisst?
--
Gerne. An den ersten beiden Alben mochte ich in erster Linie, wie Marina eigentlich völlig over-the-top mit Popkultur spielt (der Oh No!-Clip veranschaulicht das gut), ohne dass dieses Spiel zur bloßen Übersteigerung wird noch zur Parodie. Beide sind großartige Pop-Platten, mit oder ohne Überbau, aber gerade mit den manchmal richtig subtilen bis in den Sarkasmus reichenden Spitzen hatte ich immer am meisten Spaß, und als das Konzept auf Electra Heart noch ganz bowie-esk in eine Kunstfigur projiziert wurde, die noch dazu kontemporären Chart-Pop ganz uncool umarmt, während sie ihren klugen Blick über das große Ganze bewahrte, war ich im Pop-Himmel. Froot hat einen schönen roten Faden und viele tolle Einzeltracks, als Gesamtwerk finde ich es aber nicht so zwingend wie die Vorgänger. Es ist zwar nicht ohne Biss (siehe Can’t Pin Me Down), aber im Vergleich doch handzahmer. Außerdem hat es ein paar vereinzelte Füller (Gold und Weeds, um genau zu sein), davon waren The Family Jewels und Electra Heart tatsächlich weit entfernt.
--
AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970
Beiträge: 0
Beeindruckend, danke. Diese Musik regt mich nicht zum nachhören an, dein Text aber immerhin zum nachdenken.
--
Jan LustigerAußerdem hat es ein paar vereinzelte Füller (Gold und Weeds, um genau zu sein)
Die mag ich beide, vor allem „Gold“.
--
Courtney Barnett – Depreston
[Track, 2015]
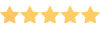
Mit Courtney Barnett gab heuer eine der vielversprechendsten Songwriterinnen seit langem ihr LP-Debüt. Auf dem wunderschön betitelten Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit geht die Australierin mit beeindruckender Beobachtungsgabe an ihre Songs heran, entdeckt den Humor und die Tragik im Alltäglichen und schaufelt so die Poesie unter der Last des schnelllebigen 21. Jahrhunderts frei. Deswegen lässt sich über ihren besten Song auch ein derart banaler Satz schreiben wie: Depreston handelt von einer Hausbesichtigung. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte.
Depreston ist eine der ruhigeren Nummern auf Barnetts Debütalbum. Zu einer dezent vorantreibenden Rhythmusgruppe spielt sie eine Mischung aus Jangle- und Country-Gitarre, deren jede Zeile beendende Hook für Pop-Appeal sorgt. Ihre Vocals legen den Fokus auf das Narrative; immer wieder mal bricht Barnett aus der introvertierten Gesangsmelodie aus, vollendet eine Zeile mal eher rhythmisch gesprochen, mal besonders melodiös, je nachdem nach was für einer Betonung die Geschichte gerade verlangt.
Ein bisschen erinnert das an die ruhigeren Sachen Lou Reeds, auch was die Suche nach der Poesie an unüblichen Orten als zentrales Bestandteil im Songwriting angeht. Allerdings begeben wir uns hier nicht nach New York, um uns Geschichten über Drogenmissbrauch und Transsexualität anzuhören. Ganz im Gegenteil führt uns Depreston raus aus der Großstadt, weg von der Avantgarde, rein ins bürgerliche Milieu.
In diesem Song nämlich begleiten wir ein Pärchen nach Preston, eine Vorstadt Melbournes mit etwa 30.000 Einwohnern. Melbourne selbst hat nämlich an Reiz verloren: „You said we should look out further / I guess it wouldn’t hurt us / We don’t have to be around all these coffee shops”. In dieser Zeile – der Einstiegszeile – geht es natürlich nicht um eine Abneigung gegenüber Kaffee. Vielmehr ist der Überschuss an Cafés ein Hinweis auf die Gentrifizierung der Stadt, wegen der man das erste eigene Haus vielleicht besser in der Vorstadt suchen sollte.
Einen guten ersten Eindruck macht die allerdings auch nicht: „We drive to a house in Preston / We see police arresting / a man with his hand in a bag“. Der Verhaftete versteckte vermutlich Alkohol in der Tasche, das erste einsame Bild in einer einsamen Gegend. „How’s that for first impressions? / This place seems depressing“ kommentiert Barnett und gibt dieser Zeile einen Doppelbezug, indem sie hinzufügt: „It’s a Californian bangelow in a cul-de-sac“. Dadurch erweitert sich der deprimierende Ersteindruck Prestons im Allgemeinen auf das besichtigte Haus im Speziellen. Das befindet sich dann auch passenderweise in einer „cul-de-sac“, einer Sackgasse.
Hier schaltet sich der Immobilienmakler ein. „It’s got a lovely garden / a garage for two cars to park in,“ zählt er auf, „or a lot of room for storage if you’ve got just one“. Schließlich sind die Zeiten, in denen ein zweites Auto Statusgewinn bedeutete, vorbei. Warum das Haus denn so günstig sei, will das Pärchen wissen. „Well, it’s a deceased estate / Aren’t the pressed metal ceilings great?“. Über die offensichtliche Tristesse von Wohnung und Umgebung, den verkaufseifrigen Makler sowie dessen Bemühungen, das Grau bunt zu zeichnen, baut Barnett einen Kontrast auf, der eine größere Tragik der Tristesse zur Folge hat. Die Versuche des Maklers, davon abzulenken, sind zum Scheitern verurteilt.
Stattdessen hat sein leiser Hinweis darauf, dass das Haus durch einen Todesfall frei wurde, zur Folge, dass der Ich-Erzählerin andere Dinge ins Auge fallen: „Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea, and flour / and a photo of a young man in a van in Vietnam“. Die Haltestange deutet darauf hin, dass in dem Haus eine ältere Person alleine gewohnt hat, das Foto eines jungen Mannes in Vietnam (Australien war am Vietnamkrieg beteiligt) zeigt vermutlich den Sohn oder Ehemann (rechnerisch ist beides möglich) der ehemaligen Hausbesitzerin. So wird über die Hauseinrichtung eine persönliche Geschichte erzählt, die in Verbindung mit der australischen Vorstadt als Setting einen Gesellschaftsbezug bekommt.
Durch die Tragik ihrer Beobachtungen relativieren sich schnell all die Gedanken, die sich Barnetts Hauptfigur bei der Hausbesichtigung eigentlich so machen würde: „And I can’t think of floorboards anymore / whether the front room faces south or north“. Stattdessen kommt sie nicht davon los, sich Gedanken über das Leben der alten Frau, die einst in diesem Haus lebte, zu machen. „And I wonder what she bought it for“, fragt sie sich in einem Augenblick, in dem nur noch wenig Sinn zu machen scheint.
Mitten in der Vorstadt-Tristesse konfrontiert mit der Vergänglichkeit in ihren Gedanken versunken, wird sie schließlich vom Makler zurück in die Gegenwart geholt: „If you’ve got a spare half a million / you could knock it down and start rebuilding“, empfiehlt er. Für schlappe 500.000 Australische Dollar also könne das Haus abgerissen und ein neues errichtet werden. Damit wären die letzten Spuren des Lebens der Vorbesitzerin ausgelöscht. An ihre Stelle tritt die sich weiter ausbreitende Gentrifizierung, die so den Kreis, den die Ausgangssituation begonnen hatte, vollendet: Ein neues teures Haus folgt dem (buchstäblichen) Tod der Mittelklasse. Fünf mal wiederholt Barnett diese Zeile mit immer steigender Eindringlichkeit, damit wir uns bewusst werden, dass der Hinweis des Maklers nichts anderes ist als eine traurige Pointe des Kapitalismus.
--
Danke für die schöne Rezension, Jan. Ich kannte Courtney Barnett bis heute nicht, „Depreston“ gefällt mir sehr. Habe mir direkt mal Vinyl bestellt, nachdem ich ein paar weitere Songs angehört habe.
--
Is this my life? Or am I just breathing underwater?Gerne!

--
-
Schlagwörter: Musik-Blog
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.