Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Curtis Clark Quintet – Letter to South Africa | Noch ein Nebengeleise: Curtis Clark kam 1950 in Chicago zur Welt, verbrachte seine „student years“ in Los Angeles, wo er in Musiktheorie, Komposition und Klavier am CalArts abschloss, aber bald merkte, „how hopeless the music scene in L.A. was (and still is)“ (Liner Notes, anonym). Er verbrachte daher ein paar Jahre in New York, um festzustellen „that N.Y. had seen its best days“, und so zog er nach Amsterdam, „the center of improvised music in Europe where he has lived the last six or seven years“. Das Album scheint 1986 oder 1987 aufgenommen/erschienen zu sein (Discogs bwz. Bruyninck), d.h. Clark ist so um 1979/80 herum nach Europa gezogen. Dennoch nimmt er ab 1984 ausgerechnet für Nimbus West auf – auch ein Album namens „Amsterdam Sunshine“, das ich aber nicht kenne. Bei mir sind bisher die drei Alben mit Südafrika-Bezug da (und das Solo-Album „Dedications“) und die sind hier natürlich auch das Thema. Louis Moholo am Schlagzeug ist die Konstante – ansonsten ist hier der Südafrika-Bezug nur indirekt da: John Tchicai spielt Tenorsaxophon und bringt wohl so einiges ein, was er bei den Sessions mit Johnny Dyani gelernt oder mitgekriegt hatte. Ernst Reijseger am Cello und Ernst Glerum am Bass waren beide schon bei „Amsterdam Sunshine“ dabei.
Der Kwela-Beat im Opener, „Serious Wishing“ (Winnie Mandela gewidmet) sitzt überraschend gut, und auch im folgenden Titelstück passt der Groove – ein richtig schöner Einstieg in ein Album, das danach auch in andere Richtungen geht. Reijsegers Cello wird in den Groove-Passagen, den Themen zur wichtigen Stimme im Band-Sound, während Clark sich mehr Freiheiten nimmt, als das die südafrikanischen Pianisten meist tun. Der Brief an Südafrika dauert 11 Minuten und wird hinten raus sehr frei – und dann lyrisch mit einem gestrichenen Cello-Solo, bevor das Thema wiederholt wird. Mit dem kurzen „Twilight Union“ endet die erste Hälfte des LP-langen Albums (das bei Discogs aber nur als CD gelistet ist). Ein Rubato-Stück ohne Sax mit gestrichenem Cello als Teil der Begleitung des Klaviers und dann mit einer Art Solo – das hätte vielleicht ohne Cello vielleicht so ähnlich fünfzehn Jahre später im Repertoire von Abdullah Ibrahim auftauchen können, aber Südafrika-Bezug hat es keinen … ist ja trotz des südafrikanischen Drummers und der Anleihen anderswo kein wirklich südafrikanisches Album … aber wie im Repertoire von Johnny Dyani oder Harry Miller finden sich auch bei Louis Moholo zahlreiche tolle Sideman-Alben, Zeugnis der Offenheit dieser grossartigen Musiker.
Teil zwei öffnet mit „What Price is Freedom“ – wie überhaupt alles Material aus der Feder des Leaders, der hier ganz alleine zu hören ist mit einem zarten Thema, begleitet von kraftvollen Akkorden, aus denen dann und wann wuchtige Ausbrüche werden, in denen der gospel- und hymnenartige Charakter des Themas erst so richtig deutlich wird. Die Musik kommt hier fast zu einem Halt – und das ist toll. Für „Admission of Guilt“ stösst Tchicai am Tenorsax dazu und übernimmt grossteils den Lead, während Clark eine zerklüftete, karge, aber sehr warme Begleitung beisteuert. Auch in diesem Stück bleibt die Zeit scheinbar stehen – da träume ich sofort von einem Duo-Album, das sich ziemlich sicher nicht vor denen vom Ascension-Kollegen Marion Brown mit Mal Waldron verstecken bräuchte. Für den „Circumstantial Blues“ stossen Glerum und Moholo wieder dazu, Tchicai spielt ein ziemlich tolles Solo, Clark klingt dann etwas Monk-artig. Und wenn das danach folgende Cello-Solo zum ersten Mal gewisse Third-Stream-Vibes aufkommen lässt, liegt das am konventionellen Material hier – das allerdings von Moholo immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Südafrika kehrt dann zumindest im Titel des Closers wenngleich nicht in der Musik noch einmal zurück, „Cape Town 2048“. Ein dichtes, freies
und kollektives Stück mit gestrichenem Bass und Cello, stotternden Beats und Rolls von Moholo.
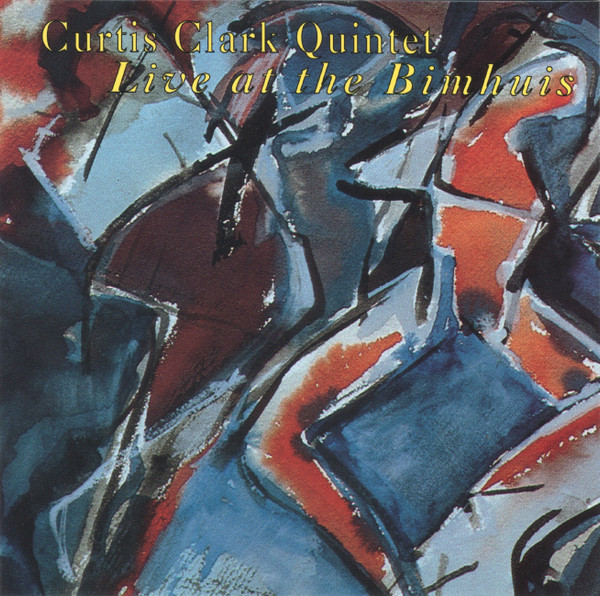
Curtis Clark Quintet – Live at the Bimhuis | Hier ist auf der CD das Aufnahmedatum aufgedruckt: „october 1988“, in den Liner Notes ist von 15 Jahren Bimhuis und dessen Gründung 1974 die Rede, d.h. das Album wird 1989 erschienen sein. Der Südafrika-Bezug ist, wie ich beim Wiederhören merke, hier aber echt nicht mehr da … ausser eben, dass Louis Moholo am Schlagzeug dabei ist – aber er agiert hier eher noch zurückhaltender als auf dem Album davor. Neben sieben Clark-Originals gibt es zweimal Fremdmaterial: Lennon/McCartney mit „With a Little Help of My Friends“ [sic] und „As Time Goes By“ (eine schöne, freie Solo-Meditation darüber), den alten Klassiker aus dem Film „Casablanca“. Die meisten Stücke des ziemlich langen Albums folgen direkt aufeinander, es gibt mehr Freiräume für alle – für Reijseger, der oft wie ein Bläser soliert, für den tollen Drummer auch, zumal in der Begleitung, und auch für den hervorragenden Bassisten – und das Chamäleon Andy Sheppard hat am Sax übernommen (hauptsächlich Sopran), und auf dem Closer stösst noch Jan Piet Visser an der Harmonika dazu. Sehr toll – gerade weil Moholo da richtig aufdreht – finde ich „Boo-Related“, in dem das Cello die Hauptrolle kriegt, ich höre das vom Material her irgendwo zwischen Chico Hamilton und dem Cello, wie es dessen ehemaliger Sideman Eric Dolphy einsetzte – dazu eine grundsätzlich freiere Spielhaltung, und man kriegt eine Art Update von Third Stream, die ziemlich eigen klingt. Im nahtlos folgenden „Deep Sea Diner“ gibt es ein langes Sopransax/Cello-Duo, das sich auf spielerische Weise zwischen eher – kann man das sagen? – traditionellem Third Stream und aktuellem Jazz mit Avantgarde-Anleihen bewegt. Dass Moholo auch in so einem Rahmen eine gute Figur macht, finde ich nicht weiter überraschend – und dennoch toll, das hören zu können.

Curtis Clark – Dreams Deferred | Im dritten Album gibt es zunächst eine Trio-Session aus dem Bimhuis mit Wayne Dockery und Louis Moholo und dann eine Studio-Session im Septett, auf der zum Trio der andere grosse niederländische (Free-)Jazz-Cellist, Tristan Honsinger, und drei Bläser dazukommen. Mit Sean Bergin (ts/ss) wirkt noch ein Exil-Südafrikaner mit, der in Amsterdam seine neue Heimat gefunden hat, dazu kommen Felicity Provan (t/voc) und Tobias Delius (ts). Die Trio-Session besteht aus fünf Monk-Stücken: „Light Blue“, „Worry Later / San Francisco Holiday“, „Well You Needn’t“, „Monk’s Mood“ und „Misterioso“ – und während es bei Clark inzwischen auf der Hand liegt, dass er das ziemlich gut kann, ist es wirklich interessant, wie Moholo mit dem Material umgeht – und wie er sich mit Dockery verzahnt. Die beiden sorgen für eine so bewegliche, offene und unvorhersehbare Begleitung, wie sie Monk nie hatte. Und das ist nirgends so sehr der Fall wie in der Ballade „Monk’s Mood“, in der die Bass-Begleitung eigentlich zur Solo-Stimme wird, während das Klavier das einfache Thema spielt. Finde diese halbe Stunde etwas vom exquisitesten, was ich in Sachen Monk-Cover kenne – auch weil Clark im selben Moment zart und zupackend, karg und prägnant ist. Vielleicht finde ich das gerade deswegen so gut, weil Clark sich Monks Stücke aneignet, sie quasi rekonstruiert und etwas völlig Eigenes in ihnen zu finden scheint, das die Vorlagen aber nie verleugnet. No mean feat!
Die zweite Hälfte mit dem Septett ist mit fast 38 Minuten ein Album für sich. Hier stammen von den sechs Stücken alle von Clark bis auf den Closer, „All the Things You Are“. Los geht es mit „Two Shadows in the Mist“ und hier ist das Cello in die sehr dicht agierende Rhythmusgruppe integriert, während die Bläser fast third-streamig mit einer seltsamen Linie darüber einsteigen – und klar ist da eine Stimme dabei: die australische Trompeterin singt hier ohne Worte, unisono mit den Macker-Saxern und improvisiert dann im Kollektiv mit. Wenn es im zweiten Stück, „Scratched“, konventioneller zu und her geht, hätte ich ganz gerne Solo-IDs der Tenorsaxer … ich tippe auf Bergin zuerst mit dem altmodisch grossen Ton und der sehr robusten Delivery, dann Delius im freieren Solo nach den Klavier- und Bass-Soli. Im folgenden „Sean“ sind die zwei Saxophone dann gleich im Dialog zu hören – und Provan fehlt gleich zum zweiten Mal. Delius spielt wohl das Tenor-Solo zum Einstieg, so krawallig wie Moholo begleitet. Danach gibt es ein ähnlich wildes Piano-Solo mit weiterhin sehr tollen Drums, und zum Abschluss ist dann wohl der Titelheld zu hören (wunderte mich nicht, wenn ich falsch liege – bin hier echt unsicher) – und Moholo beschwört ganze Stürme herauf. „Diapahne“ ist dann das nächste Cello-Feature, Honsinger mit dem Bogen – und klar: der steht Reijseger in nichts nach. Moholo trommelt eine zurückhaltende und doch sehr charaktervolle Begleitung, Clarks Piano klingt hier fast klassisch – und der Bass hat zusammen mit den Bläser*innen Pause. In „Nelson“ im mittelschnellen 6/8 sind diese dann alle dabei (statt des nun pausierenden Cellos), auch endlich wieder einmal die Trompete, das Ensemble anführend. Dockery spielt eine Art Steve Swallow-Begleitung, Clark soliert zuerst, das Ensemble kehrt zu Beginn aber nochmal zurück. Dann ist Bergin am Sopransax zu hören, während sich die Struktur auflöst, ohne dass das Tempo verschwindet – das ist ziemlich raffiniert von der ganzen Rhythmusgruppe, und es ist nicht als fair, dass Dockery hier ein Solo kriegt. Mit unbegleitetem Bass beginnt dann auch gleich der Closer von Kern/Hammerstein II, doch wenn die anderen einsteigen (ein Tenorsax – Bergin? – und Klavier, dazu Moholo) bricht auch das gleich aus, bleibt dem Stück allerdings verbunden. Danach recht freie Soli von den Saxophone. Das zweite klingt phasenweise fast wie ein Alt, wird eher Delius sein, das Cello stösst auch dazu, Moholo spielt irgendeine Trommel zum Drumkit dazu … aber statt eines von der Trompete ist Provan am Ende nochmal als Sängerin zu hören, umkreist auf gespenstische Weise ein letztes Mal das altbekannte Thema. Das Album ist überlang, aber dank der zwei klar abegrenzten Hälften gut in zwei Sitzungen hörbar – und eine ziemlich tolle Wundertüte, der Moholo noch mehr beizufügen hat als den zwei Alben davor.
Das hat jetzt mit Südafrika alles wenig zu tun – ausser dem Einstieg des ersten Albums. Die Grenzen sind halt fliessend und verschieben sich. Wenn Harry Miller gegen Ende seines tragischer verkürzten Lebens ein Jahrzehnt früher auf „Down South“ Niederländer (und damit längst besser vertraute Engländer) an die Grooves seiner Heimat heranführte – und auch Sean Bergin da schon dabei war – so ist hier ein US-Expat zu hören, der die Südafrikaner einbezieht in seine auch sehr eigene und reichhaltige Musik. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Alben ohne Moholo wesentlich weniger gut geworden wären.
Und das hier ist auch eine Überleitung zum letzten grossen Kapitel, das ich noch vor mir habe: Louis Moholo-Moholo und seine Leader-Karriere, die um den Dreh herum beginnt … aber das muss etwas warten, weil übermorgen meine Sommerfestival-Wochenenden beginnen und ich mir genügend Zeit für die vielen Alben lassen möchte.
—
Nachtrag: Nachruf auf Curtis Clark mit einem längeren Abschnitt von seiner ältesten Tochter:
http://www.coastalcremationservices.com/Content/Sidebar/FOV2-00014E83/S00D0BBE4-00D0BF71
--
"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #165: Johnny Dyani (1945–1986) - 9.9., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba